| Volltext anzeigen | |
Anwerbevereinbarungen Auf die 1955 mit Italien, 1960 mit Spanien und Griechenland abgeschlossenen ersten Anwerbevereinbarungen der Bundesrepublik Deutschland folgten weitere mit der Türkei (1961) und Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968). Vom Ende der 1950er-Jahre bis 1973 kamen rund 14 Millionen ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland, ca. elf Millionen kehrten wieder zurück, die anderen blieben und zogen ihre Familien nach. 1961 hatte es 550 000 ausländische Arbeitskräfte in der Bundesrepublik gegeben, 1973 waren es 2,6 Millionen. Am stärksten vertreten waren zuerst Italiener, Spanier und Griechen. Seit Ende der 1960er-Jahre wuchsen dann die Anteile der Jugoslawen und vor allem der Türken. Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger betrug in der Bundesrepublik im Jahr 1960 nur 1,2 Prozent, 1970 dann bereits 5 Prozent und stieg bis 1980 auf 7,2 Prozent weiter an, um in den 1980er-Jahren annähernd auf dieser Höhe zu bleiben. Debatten führen zum Anwerbestopp Schon in den späten 1960erJahren ließ sich beobachten, dass immer mehr Zuwanderinnen und Zuwanderer ihre Familien nachholten und die Rückkehrorientierung nachließ. Allenthalben entbrannten Diskussionen, die das Fortschreiten der Einwanderung dokumentierten. Im Vordergrund stand die Zunahme der Konkurrenz um Wohnraum in Großstädten, weil Zuwanderer immer seltener die Wohnheime der Unternehmen in Anspruch nahmen. Gleichermaßen ging es aber auch um die verstärkte Nutzung der kommunalen Infrastruktur (vor allem Schulen, Kindergärten), die Inanspruchnahme von Leistungen der sozialen Sicherungssysteme oder die Repräsentation von Migranten insbesondere im politischen Raum der Kommunen. Während auf kommunaler Ebene zunehmend intensiver über die Erfordernisse und Möglichkeiten der Förderung bzw. Begleitung der Integration diskutiert wurde, gewann auf Bundesund Landesebene die vor allem von den Innenministerien vertretenen Auffassungen die Oberhand, die nach einer verstärkten Kontrolle, Steuerung bzw. Verminderung des Zustroms strebten. Der Stopp der Anwerbung 1973 bildete ein zentrales Ergebnis der seit den späten 1960er-Jahren laufenden Diskussionen um die Verstärkung der Tendenzen zur dauerhaften Einwanderung (u M2). Die Bundesrepublik wird zur neuen Heimat Anders als die Politik geglaubt hatte, sank mit dem „Anwerbestopp“ 1973 die Zahl ausländischer Staatsangehöriger nicht ab, weil die Tendenz gewachsen war, die Bundesrepublik nicht nur als kurzfristigen Arbeitsort zu verstehen. Immer mehr Frauen, Männer und Familien, die zugewandert waren, sahen hier ihren Lebensmittelpunkt. Das zeigte sich beispielsweise auch an der Zahl der Kinder und Jugendlichen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Im Schuljahr 1965/66 hatte es beispielsweise nur 35 000 ausländische Schülerinnen und Schüler an bundesdeutschen Schulen gegeben. 1970/71 lag ihre Zahl bereits bei 160 000, 1975/76 dann schon bei 385 000. 1980 hielt sich ein Drittel der ausländischen Staatsangehörigen bereits zehn oder mehr Jahre in Deutschland auf, 1985 lag der Anteil schon bei 55 Prozent. 2016 hatten über 20 Prozent der Bewohner Deutschlands einen Migrationshintergrund (u M3). i Großer Empfang des millionsten „Gastarbeiters“. Foto vom 10. September 1964. Vertreter der Arbeitgeberverbände begrüßten den 38-jährigen Armando Rodrigues de Sá aus Portugal auf dem KölnDeutzer Bahnhof und schenkten ihm Blumen und ein Moped. Internettipp: Zum Anwerbeabkommen siehe Code 32021-10 Literaturtipp: Jeannette Goddar und Dorte Huneke (Hrsg.), Auf Zeit. Für immer, Zuwanderer aus der Türkei erinnern sich, Bonn 2011 149„Wirtschaftswunder“ und „Gastarbeiter“: Immigration in die Bundesrepublik nach 1945 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
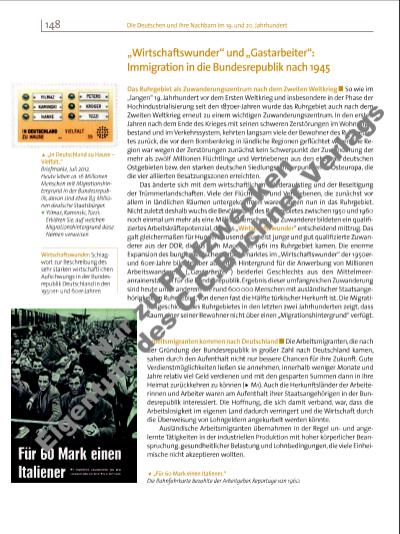 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |