| Volltext anzeigen | |
Geordnete Verhältnisse – Strukturmerkmale der Ständegesellschaft Die evangelischen Landeskirchen boten keine vergleichbaren Positionen, die der Adel zu besetzen wünschte. Die evangelischen Pfarrhaushalte bildeten ein relativ homogenes Milieu, dessen Angehörige in ihren eigenen Kreisen heirateten. Sie versuchten, die unter Bürgern und Landbevölkerung begehrten Stellen möglichst an ihre Kinder weiterzugeben. Der Adel Der Adel bestimmte das politische, soziale und kulturelle Geschehen im Reich. Kennzeichen seiner herausgehobenen Stellung waren seine Abstammung und sein Selbstverständnis, über andere Menschen Macht auszuüben. Er beanspruchte die führenden Positionen in Staat, Kirche und Gesellschaft. Adlige durften Titel führen, genossen weitgehende Steuer freiheit und durften nur von Angehörigen des eigenen Standes abgeurteilt werden. In sich war der Adel jedoch stark differenziert. Es gab den reichsunmittelbaren, also direkt Kaiser und Reich unterstehenden, sowie den landsässigen, von einem Landesherrn abhängigen Adel. Der Kaiser und die reichsunmittelbaren weltlichen und geistlichen Adligen (Kurfürsten, Herzöge sowie reichsunmittelbare Grafen und Herren) waren als Angehörige des Hochadels und als Landesherren auf den Reichstagen vertreten. Rang und Bedeutung der Adligen hingen zudem jeweils von ihrer wirtschaftlichen Lage und ihrem Besitz, ihren Ämtern und Privilegien ab. Unabhängig von ihrem Rang verband die Angehörigen des Adels ein verpfl ichtendes Ethos. Danach gehörten der Kriegsdienst, die Bewirtschaftung der eigenen Güter, die Jagd sowie „Rat und Hilfe“ für König oder Landesfürsten zu ihren vornehmsten Tätigkeiten. Den Lebensunterhalt mit Arbeit zu verdienen, galt als unehrenhaft. Den Landesfürsten gelang es im 14. und 15. Jahrhundert, ihre Einfl ussbereiche durch Eheschließungen, Erbschaften, Kauf, Tausch und Kriege zu zusammenhängenden Territorien auszubauen. Damit gerieten viele Adlige unter ihre Herrschaft und wurden „landsässig“. Der „gemeine Mann“ So wie dem König oder Kaiser auf Reichsebene die Reichsstände gegenübertraten, nahmen Adel, Geistlichkeit, Städte und manchmal auch die Bauernschaft als „Landstand“ diese Aufgabe gegenüber dem Landesherrn wahr. Die Bauern waren jedoch nur in einigen Teilen des Reiches ein „Stand“ in diesem Sinne, etwa in Teilen Südwestdeutschlands oder im Territorium des Erzbischofs von Salzburg. In den anderen Gegenden galt der Bauer als der „arme Mann“, der nicht herrschaftsfähig war, sondern Schutz bedurfte und daher der Obrigkeit unterstand. Die Geschichtswissenschaft hat dafür den Begriff „unterständische Schicht“ geprägt. Seit etwa 1500 bezeichneten sich Bauern und städtische Einwohner ohne Bürgerrecht, wie Gesellen und Dienstboten, oder die Bürger ohne Zugang zu den Ämtern als der „gemeine Mann“. Das Lehnswesen Der größte Teil des Grundbesitzes befand sich in der Hand des Königs oder in den Händen von Adligen, Bischöfen oder Klöstern, die das Land als Vasallen des Königs als Lehen erhalten hatten (Lehnswesen). Der König, der seine Herrschaft durch seine Herkunft, die Anerkennung durch die Fürsten und die Gnade Gottes legitimierte, regierte ohne feste Hauptstadt (Reise königtum). Er benötigte in allen Regionen Personen, die für ihn Verwaltungsaufgaben übernahmen. Diese fand er im Adel und in der Kirche. Als oberster Lehnsherr ging er ein persönliches Rechtsverhältnis mit den höchsten Adligen seines Reiches ein. Diese Beziehung wurde durch einen i Menschen gestalten die Landschaft. Gemälde aus einer Handschrift, um 1500. Die Gebetbücher der Adligen enthielten Monatsbilder mit den typischen Tätigkeiten der Jahreszeit, hier das Monatsbild für März. Die Bauern werden zwar in Kleidung und Gesichtszügen derber gezeichnet als die Herren, ihre Arbeit wird aber hoch geschätzt. „armer Mann“: hier in der Bedeutung von „schwach“, Person mit minderem Rechtsstatus Literaturtipp: Wie groß war die Macht des Adels im Mittelalter? Diese und andere Fragen beantwortet Claudia Märtl in ihrem Band „Die 101 wichtigsten Fragen. Mittelalter“, München 22007 161 Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
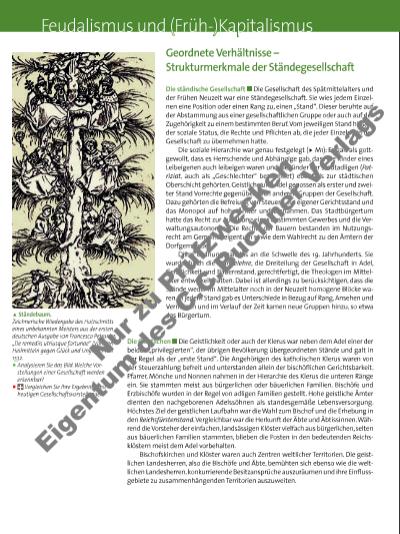 « | 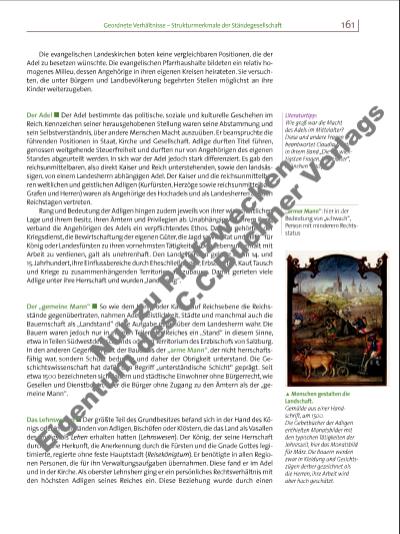 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |