| Volltext anzeigen | |
Geordnete Verhältnisse – Strukturmerkmale der Ständegesellschaft Herrschaft und Freiheit auf dem Land Die Untertanen standen in unterschiedlicher Abhängigkeit zum Grundherrn. Diese reichte vom bloßen Pachtverhältnis bis zur Leib eigenschaft. Neben hörigen Bauern, die das vom Grundherrn geliehene Land unter den festgelegten Bedingungen selbstständig bewirtschafteten, gab es das unfreie Gesinde. Es arbeitete in persönlicher Abhängigkeit, oft auch in Leibeigenschaft auf dem Herrenhof und dem umliegenden Land. Leibeigene durften ohne Genehmigung ihres Herrn weder heiraten noch wegziehen. Wenn es einem Leibeigenen allerdings gelang, das Territorium einer Stadt zu erreichen und dort dauerhaft Aufnahme zu fi nden, entkam er der Rechtsprechung des Grundherrn.* Der Abhängigkeitsgrad bestimmte Art und Umfang der Frondienste. Ein unfreier Bauer musste gewöhnlich mehr Dienste und Abgaben leisten als ein freier Bauer. Das Verhältnis zwischen Grundherren und Bauern war zwar durch Ungleichheit und Abhängigkeit gekennzeichnet, doch rechtlos waren die Bauern nicht. Es ist vielfach belegt, dass sie Widerstand leisteten, wenn sie ihre „alten“ Rechte, die durch ihre Generationen übergreifende Dauer als unumstößlich galten, durch Landesund Grundherren bedroht sahen. Im 15. und 16. Jahrhundert erhoben sich immer wieder Bauern in verschiedenen Regionen gegen ihre Obrigkeiten. Sie verweigerten Dienste und Abgaben und rotteten sich zu bewaffneten „Haufen“ zusammen. Im Bauernkrieg von 1524 bis 1526, der größten Erhebung der Bauern in Europa, wurde die ständische Ordnung auch grundsätzlich infrage gestellt. Die Aufstände wurden niedergeschlagen, jedoch machte die Obrigkeit den Bauern nun mehr Zugeständnisse, da die Grundherren ein Interesse daran hatten, die Arbeitskräfte auf dem Land zu halten. Selbstbewusstsein durch Abgrenzung Der Platz des Einzelnen in der Gesellschaft ergab sich zwar durch die Zugehörigkeit zu einem Stand – gesichert war er dadurch jedoch nicht. Die öffentliche Wertschätzung einer Person und ihr sozialer Status hingen nicht allein von Herkunft und Vermögen ab, sondern waren vor allem durch Ehre und soziales Prestige bestimmt. Davon besaß der Adlige mehr als der Bürger und dieser wiederum mehr als der Bauer. Da die Ehre einer Person von der Beachtung anderer abhing, musste das, was man war, durch angemessenes Verhalten und einen standesgemäßen Lebensstil öffentlich gezeigt werden. Je höher der Rang, desto höher hatte der Aufwand bei der Größe und Ausstattung der Häuser, bei Festen, Kleidung und Schmuck oder der Zahl der Bediensteten zu sein. Wie wichtig es war, seine Position immer wieder zu sichern, zeigen die Kämpfe um die Rangordnungen, die Sitzordnung in der Ratsstube und im Kirchengestühl sowie die Prozessionsfolge bei Empfängen oder Begräbnissen. Die soziale Rangordnung spiegelte sich in den von der Obrigkeit erlassenen Kleiderordnungen.** Diese legten genau fest, welche Kleidung für welchen Stand oder Rang angemessen war. Um den eigenen Stand zu sichern, waren die Menschen besonders darauf bedacht, sich „nach unten“, d. h. gegenüber unteren Schichten und Randgruppen, abzugrenzen. Wichtigstes Mittel zur Abgrenzung war die „standesgemäße Heirat“, auf die nicht nur Adel und Patriziat, sondern auch Kaufl eute, Handwerker und Bauern Wert legten. * Siehe S. 171. ** Vgl. dazu den MethodenBaustein auf S. 29 31 sowie S. 176. i Adel, Geistliche (Klerus) und Bauern. Malerei aus einer französischen Handschrift, 14. Jh. 163 Nu zu P rü fzw ck en Ei g nt u d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 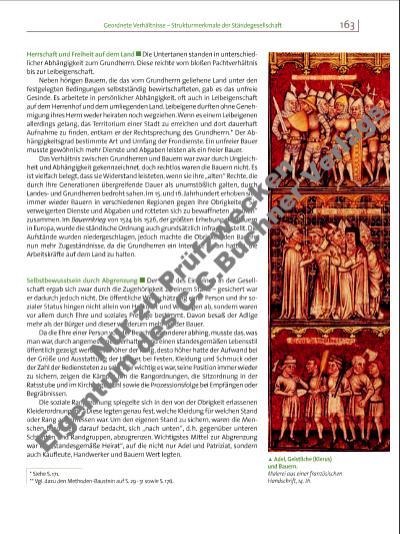 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |