| Volltext anzeigen | |
Geordnete Verhältnisse – Strukturmerkmale der Ständegesellschaft Nach der Vertreibung aus den Städten entstand in kleinen Landgemeinden ein Landjudentum, das sich insbesondere in den kleinen Territorialstaaten Südwestdeutschlands einschließlich des heutigen Bayerisch-Schwaben niederließ, und dort vor allem in den Gebieten, in denen die Habsburger Kaiser den Juden Reichsschutz gewährten. Da ihnen nahezu alle Berufe versperrt waren, verdienten viele Landjuden ihren Lebensunterhalt im Kleinund Zwischenhandel mit Vieh, Getreide und Hopfen, als Hausierer mit Stoffen und Kleidung aus städtischen Manufakturen oder sie zogen als Trödelund Betteljuden durch die Lande. Einigen wenigen Juden gelang es im 17. und 18. Jahrhundert, als Bankiers und Finanziers an den Fürstenhöfen Ansehen zu erwerben („Hofjuden“). Im Zeitalter der Aufklärung bildete sich eine jüdische Elite heraus, die den Grundstein für den geistigen, später auch gesellschaftlichen Aufstieg des Judentums legte. Immer mehr Gebildete forderten die Anerkennung der Juden als gleichberechtigte Staatsbürger. Erst mit den um 1800 einsetzenden Reformen wurde dieses Ziel allmählich verwirklicht. Möglichkeiten und Grenzen sozialen Aufstiegs Trotz vieler unveränderlicher Merkmale war die Ständeordnung in der Frühen Neuzeit auch durch sozialen Wandel geprägt: Die traditionellen Geburtsund Berufsstände differenzierten sich aus, neue soziale Gruppen stiegen auf, alte Eliten ab. Die meisten Menschen blieben zwar in dem Stand, in den sie hineingeboren waren, ein sozialer Aufstieg war jedoch in wenigen Fällen durch Vermögen, Bildung und – bei Frauen fast ausschließlich – über Heirat möglich. In den Kirchen boten sich die besten Möglichkeiten, die Standesschranken zu überwinden. Wie der Adel waren das Bürgertum und wohlhabende Bauern darauf bedacht, ihren nachgeborenen Söhnen angesehene geistliche Ämter und Einnahmen (Pfründe) zu sichern. Manchmal gelang auch ein Aufstieg aus einfachen Verhältnissen, wenn ein Verwandter, Pate oder Freund der Familie dem Schützling zunächst Schule und Studium fi nanzierte und ihm danach durch gezielte Fürsprache (Patronage) zu einer Pfarrerstelle oder einer Position als Abt oder Äbtissin eines Klosters verhalf. In den Städten war ein sozialer Aufstieg nur in den von den Zünften gesetzten Grenzen möglich, so der Sprung vom Handwerksgesellen zum Meister durch die Heirat einer Meisterwitwe. Vielfach schafften es Familien über ein oder zwei Generationen, sich mit erfolgreichem Handel ein Vermögen zu er arbeiten und durch Einheirat in das Patriziat aufgenommen zu werden. Patri zische Familien wiederum bemühten sich durch den Erwerb von Grundbesitz um die Aufnahme in die landsässigen Adelsfamilien. In seltenen Fällen, wie bei der Augsburger Unternehmerfamilie Fugger, gelang sogar der Aufstieg in den Grafenstand. In der Frühen Neuzeit gewannen Bildung und akademische Abschlüsse als Aufstiegsfaktoren an Bedeutung. Seit dem 15. Jahrhundert konnten in den wachsenden städtischen und landesherrlichen Verwaltungen, den Universitäten, dem Militär und in den Reichsinstitutionen Juristen und andere akademisch Gebildete aus dem Stadtbürgertum in hohe Positionen aufsteigen, dabei als qualifi zierte Beamte im Fürstendienst sogar den begehrten Adelsbrief erhalten. Im 16. Jahrhundert kam der Doktorgrad einem Adelstitel gleich. Am Ende des 18. Jahrhunderts überdeckte das bürgerliche Leistungsethos die traditionellen Leitbilder, die den Führungsanspruch des Adels begründet hatten. i Jüdische Wanderspielleute (Klezmer). Zeichnung von Hans Bol, um 1560. i Verteilung der Stände in Deutschland um 1500 und 1800. Nach: Paul Münch, Lebensformen in der Frühen Neuzeit 1500 bis 1800, Berlin 1992, S. 77 1500 1800 Adel (herrschender Stand) 1 2 % 1 % Bürger (Stadtbewohner) 20 % 24 % Bauern (Landbewohner) 80 % 75 % davon: Hofbesitzer 60 % 35 % Landarme und besitzlose Familien 20 % 40 % 165 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 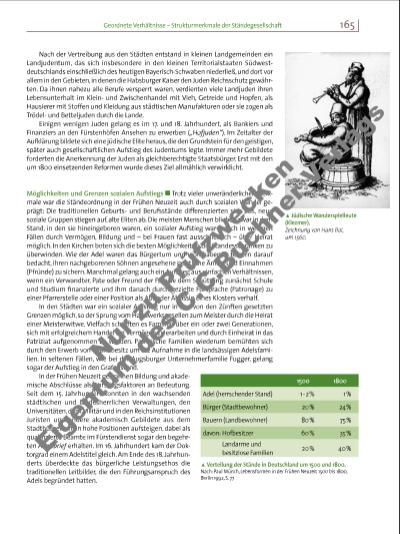 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |