| Volltext anzeigen | |
173 hirten, Schweinehirten und Schäfer. Aber auch Kunstmaler, Glasmaler, Münzmeister, ja sogar Schauspieler und Gaukler und – für uns heute noch überraschender – Ärzte galten als Handwerker. Es gab eben noch keine eigentlichen „akademischen“ Berufe; „studiert“ wurde nur in Klosterund Domschulen. Erst im Spätmittelalter bildeten sich dann mit den zahlreich entstehenden Universitäten (z. B. Prag 1348, Erfurt 1379 oder Heidelberg 1385) auch nicht-theologische akademische Berufe aus, z. B. Juristen und studierte Ärzte. Letztere unterschied man als „Leibärzte“ (medici) von den weiterhin als Handwerker geltenden „Wundärzten“ (chirurgi). Die große Bedeutung und z. T. hohe Spezialisierung mittelalterlicher Handwerker spiegelt sich noch heute in verbreiteten Familiennamen: von der Masse der „Schmied“ (Schmidt, Schmitz u. Ä.), „Müller“, „Weber“, „Maurer“, „Zimmermann“ bis zu den ganz speziellen und daher weniger häufi gen wie „Stellmacher“ (Wagenbauer), „Leinenweber“ oder „Seifensieder“. Auch die Schmiede spezialisierten sich wieder als Goldschmiede, Eisenschmiede, Hufschmiede, Grobschmiede. Vom Grundbedarf der Menschen aller Schichten her waren Textilherstellung, Bautätigkeit und Schmiedekunst sowie natürlich Bäcker und Fleischer die wichtigsten Handwerkszweige. Dabei bildeten Textilarbeiten schon früh die Domäne der Frauen – sei es als harte Arbeit, sei es als Freizeitbeschäftigung vornehmer Damen (u M2; noch bis weit in die Neuzeit porträtierte man sie gerne am Spinnrad oder mit dem Stickrahmen). Zwar traf man schon in den frühmittelalterlichen Städten auf Werkstätten einzelner Handwerker, die noch heute aus Viertelund Straßennamen vertraute Konzentration einzelner Handwerkszweige in bestimmten Wohnbezirken (z. B. „Färbergasse“, „Gerberau“, „Fleischstraße“, „Brotstraße“) ist jedoch erst eine Erscheinung des späten Mittelalters. Von der erzbischöfl ichen Stadtherrschaft zur freien Reichsstadt Die mittelalterliche Stadt war kein herrschaftsfreier Raum, sie unterstand zunächst einem Stadtherrn. Auch Stadtbürger waren Untertanen. Stadtherr konnte der Bischof sein, der König oder ein weltlicher Herr (wie in Freiburg der Herzog Konrad von Zähringen; vgl. M1, S. 177). Die zunehmende Ausweitung des Handelsund Geldwesens stärkte die Wirtschaftskraft und das Selbstbewusstsein der Städte, die sich bemühten, ihre Rechtsstellung gegenüber dem Stadtherrn zu stärken. In manchen Gründungsstädten wurden die Bürger von Anfang an mit umfassenden Freiheiten ausgestattet (wie z. B. in Freiburg). Denn die Stadtgründer erkannten, welch großen Nutzen die neue Lebensund Organisationsform Stadt auch ihnen brachte, wirtschaftlich, militärisch und zivilisatorisch. Seit der Ottonenzeit (919 1024) erlangten zahlreiche Bischöfe für ihre Stadt königliche Hoheitsrechte wie das Münzrecht, das Zollund Marktrecht, das Befestigungsrecht und die eigene Gerichtsbarkeit. Da aber die Stadtherren diese Rechte nicht mit den Bürgern teilen wollten, setzte vielerorts ein zäher Kampf um deren Ausübung ein. Auch wenn die Städter zuweilen Rechte erkauften, kam es doch immer wieder zu gewaltsamen Erhebungen und sogar zu blutigen Auseinandersetzungen. In Köln griffen die Bürger erstmals 1074 zu den Waffen gegen ihren Stadtherrn, Erzbischof Anno II. (1056 1075), um für sich Herrschaftsfreiheit und Selbstbestimmung zu erreichen (u M3). Anno hatte das Osterfest in Köln mit seinem Gast, dem Bischof von Münster, gefeiert. Für dessen Rückreise nach den Feiertagen ließ er ein Kaufmannsschiff beschlagnahmen, das schon für die Ausfahrt beladen war. Freie Kaufl eute konnten sich bei Reisen und Transporten auf alte Privilegien berufen. Sie waren nicht verpfl ichtet, geistlichen und weltlichen Herren zu dienen. Schon der karolingische Kaiser Ludwig der Fromme hatte ihnen zugesichert, „ihre Schiffe nicht für Unseren Bedarf wegzunehmen“. Ein heftiges Handgemenge artete bald in regelrechte Kämpfe in der i Handwerker in einer mittelalterlichen Stadt, hier: Stiefelmacher. Miniatur, um 1210. Die Stadt und ihre Bürger im Mittelalter: das Ringen um die städtische Freiheit Literaturtipp: Felicitas Schmieder, Die mittelalterliche Stadt, Darmstadt 32012 Neben Informationen zur Vorgeschichte der mittelalterlichen Stadt, zur Siedlungs und Stadtentstehung im Deutschen Reich sowie zur Ausdifferenzierung der mittelalterlichen Stadtgesellschaft, widmet die Autorin auch den Emanzipationsbestrebungen einzelner Städte wie Worms, Mainz und Köln ein eigenes Kapitel. Nu r z P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
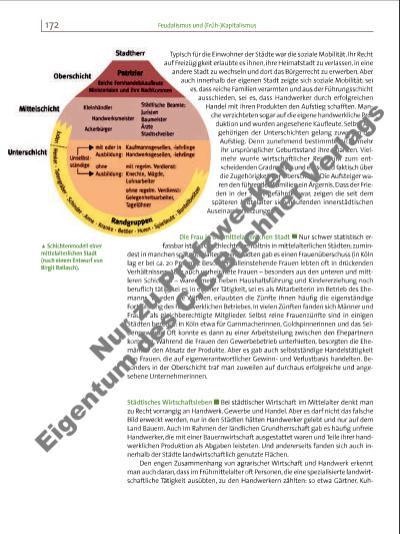 « | 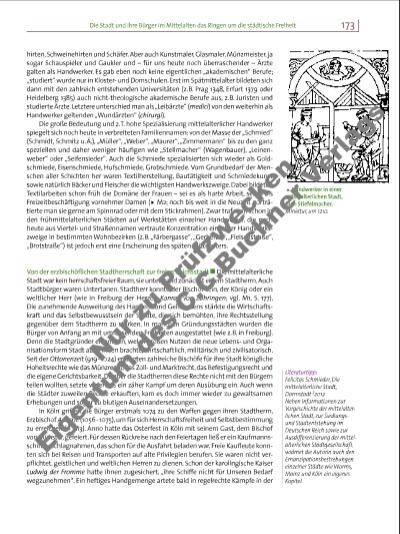 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |