| Volltext anzeigen | |
175 herr und Stadt führten jedoch immer wieder zu Konfl ikten. Als die Bürger 1216 einen Rat und damit eine eigene, nicht auf den Stadtherrn vereidigte „Behörde“ einrichteten, rief das Strafaktionen des Erzbischofs hervor. Nach immer neuen Konfl ikten ließ sich 1258 Konrad von Hochstaden auf den Versuch eines rechtlichen Ausgleichs mit den Bürgern ein. Es wurde ein Schiedsgericht aus fünf angesehenen Geistlichen bestimmt: „von dem ehrwürdigen Vater, dem Erzbischof von Köln, einerseits und den Kölner Bürgern andererseits gemeinsam erwählte Schiedsrichter“, wie es hieß. Der Schiedsspruch – in einer umfangreichen Urkunde (zehn Druckseiten!), dem sogenannten „Großen Schied“, festgehalten – listete zunächst 53 erzbischöfl iche und 21 städtische Beschwerden auf, die von den fünf Schiedsrichtern geprüft und dann entschieden wurden. Damit hatte Köln eine weitere Etappe auf dem langen Weg der Stadt zur Freiheit innerhalb des Reichsverbandes erreicht. Aber es sollte noch über 200 Jahre dauern, bis 1475 Kaiser Friedrich III. (1440 1493) in einem Privileg erklärte, die Stadt Köln sei nur Kaiser und Reich unmittelbar zugehörig. Keinem Erzbischof sei es zukünftig erlaubt, die Stadt als „seine Stadt“ zu bezeichnen oder ihre Bewohner als „seine Bürger und Getreuen“ anzusprechen. Köln hatte den Höhepunkt seiner Autonomie erlangt, es war nun „Freie Reichsstadt“. Bürgerkämpfe in der Stadt Nicht nur im Verhältnis zwischen Stadtherr und Stadt, auch innerhalb der städtischen Einwohnerschaft entbrannten seit dem 14. Jahrhundert immer wieder Kämpfe um Einfl uss und Macht. Die Patrizier waren kaum bereit, ihre beherrschende Stellung im Rat beschneiden zu lassen. Aber zunehmend machten ihnen die wohlhabender gewordenen Zünfte und aufsteigende Kaufmannsfamilien diesen Vorrang streitig. Oft erhoben diese ihre Forderungen gerade dann, wenn die Stadt in unruhigen Zeiten unter fi nanziellen Schwierigkeiten litt. Dabei wurden Vorwürfe laut wie Geheimwirtschaft und korruptes Verhalten, mangelhafte Amtsführung und letzthin daraus entstehender Schaden für das Gemeinwohl. Insbesondere das „Ungeld“ (Akzise), eine indirekte Steuer auf Verzehr (Wein und Bier, Lebensmittel), und seine häufi ge Erhöhung (Spanne zwischen 1 und 17 Prozent) lösten erbitterten Streit aus. Nicht überall erhoben sich die Bürger, und die Reaktionen der Patrizier unterschieden sich von Stadt zu Stadt. Wenn in Nürnberg die Aufständischen den Rat verjagten, anschließend aber rücksichtslos niedergeschlagen wurden, so kam es anderwärts zur stärkeren Vertretung der Zünfte im Rat. Im neu gebildeten Augsburger Rat stellten sie gar die Mehrheit. Neben den Zünften sah man dort immer häufi ger wohlhabende Kaufl eute. Zuweilen vermitteln die Quellen den Eindruck, dass sich solche Bewegungen wie ein Flächenbrand ausbreiteten. Offenbar steckte eine Stadt eine benachbarte andere an. In Städten mit verbreitetem Textilexport, wie etwa in Konstanz und Augsburg oder im Norden in Stendal, aber auch in fl andrischen und italienischen Städten, waren es häufi g die Weber, die sich erhoben. So auch 1370 in Köln. Hier war es das mitgliederstarke „Wollenamt“, die genossenschaftliche Vereinigung der Weber und der von diesen abhängigen Hilfsgewerbe, das sich an die Spitze der kommunalen Opposition setzte. „Weber“ wurde bald von einer i Gotisches Siegel der Stadt Köln. Moderner Abdruck aus dem Kölnischen Stadtmuseum. Die Inschrift lautet: „SANCTA COLONIA DEI GRACIA ROMANE ECCLESIE FIDELIS FILIA“ (Das heilige Köln, von Gottes Gnaden getreue Tochter der römischen Kirche). Die Stadt und ihre Bürger im Mittelalter: das Ringen um die städtische Freiheit Nu r z u P üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
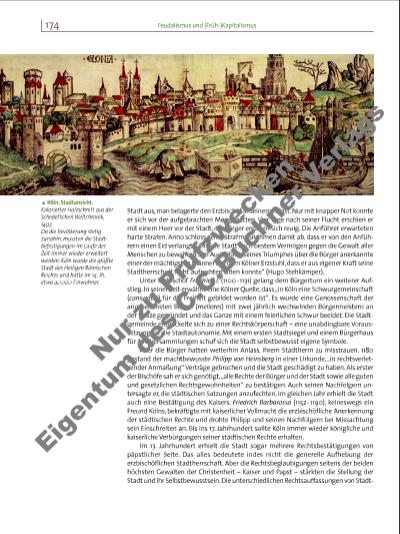 « | 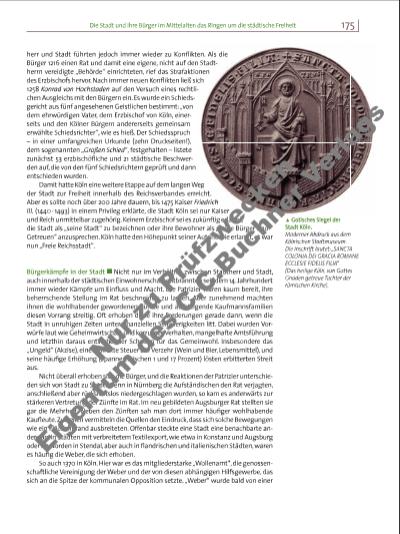 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |