| Volltext anzeigen | |
185 Von der Hände Arbeit leben – bürgerliche und bäuerliche Arbeitswelten Kaufmannsund Städtebünde Im späteren Mittelalter schlossen sich häufi ger Fernhändler zusammen, um gemeinsam mit stärkerer Kapitalkraft eigenständige Fernhandelssysteme aufzubauen. So entstanden in Süddeutschland verschiedene Handelsgesellschaften für den Mittelmeerhandel. Am bedeutsamsten wurde jedoch der Städtebund der Hanse. Dieser Bund bestimmte nicht nur lange die wirtschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung im niederdeutschen Raum, sondern betrieb auch eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik jenseits seiner Grenzen. Noch heute lassen die „Hansestädte“ etwas von der führenden Rolle im mittelalterlichen Wirtschaftsleben erahnen. Am Anfang der Entwicklung stand die Bildung von Kaufmannshansen. Mittels dieser genossenschaftlichen Zusammenschlüsse hofften die Kaufl eute, ihre gemeinsamen Interessen durchzusetzen. Sie wollten den Schutz ihrer Waren – beispielsweise vor Seeräubern – verbessern und durch ein geschlossenes Auftreten die zahllosen Zölle in den unterschiedlichen Herrschaftsgebieten bekämpfen, dazu wertvolle Handelsprivilegien im Ausland gewinnen. Die Heimatstädte machten sich die Interessen ihrer Kaufl eute zu eigen und schlossen sich seit dem späten 13. Jahrhundert selbst zusammen. An der Spitze des relativ locker organisierten Bundes stand Lübeck. Der Hanse gehörten im 15. Jahrhundert rund 70 aktive und 100 weitere Städte an der Nordund Ostseeküste und im Binnenland an. Die wichtigsten Entscheidungen wurden auf den Lübecker Hansetagen getroffen. Die Hanse kann bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert als mächtigster Interessenverband des Mittelalters bezeichnet werden. In den nordeuropäischen Wirtschaftszentren besaß sie privilegierte Handelsplätze („Kontore“, in Brügge und London im Westen, Bergen im Norden und Nowgorod im Osten). Die große Leistung der Hanse bestand darin, einen Wirtschaftsraum um Nordund Ostsee zu schaffen und Massengüter wie Getreide, Holz und Fisch aus dem Osten und Norden in die bevölkerungsreichen Gewerbezentren Westund Mitteleuropas zu verfrachten, die dafür handwerkliche Produkte und Salz lieferten. Insgesamt war der Handel die wichtigste Quelle der städtischen Wirtschaftsmacht. Damit waren auch die Fernhändler eine tonangebende und angesehene Schicht. Verlag und Manufaktur: Vorboten der Moderne Städtische Kaufl eute waren daran interessiert, große Mengen preiswerter Waren abzusetzen. Die hohen Qualitätsnormen der städtischen Zünfte waren da ebenso hinderlich wie deren Lohnforderungen. So ließen die Fernhändler lieber die wachsende Zahl von Nebenerwerbsbauern, von Söldnern und Tagelöhnern für sich arbeiten, die sich von ihren kleinen Äckern nicht ernähren konnten, durch keine Zunft geschützt wurden und gezwungen waren, auch für niedrige Löhne zu arbeiten. Auf diese Weise entstand seit dem späten Mittelalter eine neue Form der Produktion: das Verlagswesen. Der Kaufmann legte den ländlichen Arbeitern Rohstoffe und Werkzeuge vor und bezahlte ihre Arbeitskraft. Die gefertigten Produkte verkaufte der Verleger schließlich auf eigene Rechnung. Im Verlagswesen wurde nicht mehr wie im traditionellen Handwerk von dem selbstständigen Handwerksmeister für den jeweiligen Auftraggeber gefertigt, sondern von angestellten Lohnarbeitern in Heimarbeit standardisierte Massenware für einen größeren Markt hergestellt. Arbeit und Kapital, etwa für Werkzeuge, Rohstoffe oder Materialien, lagen nicht mehr in einer Hand. Das Einkommen eines Heimwebers hing davon ab, wie viel der Verleger nach seiner Einschätzung des Marktes zu zahlen bereit war. Die kapitalistische Marktwirtschaft begann sich auszubilden (u M2). Internettipp: Zur Hanse siehe Code 32021-13 i Die Hanse-Kogge, Highlight der Dauerausstellung des Deutschen Schifffahrtsmuseums Bremerhaven. Foto von 2007. Die Kogge wurde 1962 im Europahafen von Bremen gefunden. Sie ist 23,3 Meter lang und 7,6 Meter breit und wurde vermutlich im Jahr 1380 gebaut. Koggen waren zwischen dem 12. und dem 14. Jh. der dominierende Schiffstyp im Nord und Ostseehandel. Die hier gezeigte Hanse-Kogge hatte einen Laderaum von rund 150 Kubikmetern und konnte etwa 80 Tonnen tragen. Damit gehörte sie zu einem kleineren Modell, denn Aufzeichnungen aus dem 14. Jh. zeigen, dass größere Koggen damals schon bis zu 200 Tonnen Gewicht transportieren konnten. Nu r z u Pr üf zw ck en E g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
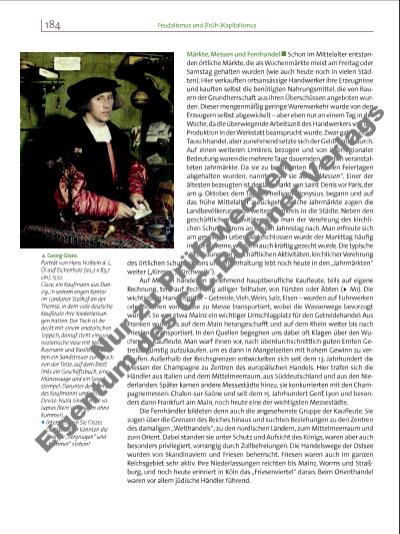 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |