| Volltext anzeigen | |
Der Frühkapitalismus der Handelshäuser Mit den weltweiten Verfl echtungen wuchsen die wirtschaftlichen Organisationsformen. Das Mittelalter kannte den Typus des Kaufmanns, der selbst mit seiner Ware über das Land zog und eine angemessene Entlohnung seiner Arbeitskraft anstrebte. Er wurde seit dem 14. Jahrhundert abgelöst – obgleich nicht verdrängt – von Handelshäusern. Mit ihnen verbreitete sich im 15. / 16. Jahrhundert der Frühkapitalismus. Diese neue Wirtschaftsform zeichnete sich dadurch aus, dass die Kaufl eute bei hohem Kapitaleinsatz maximalen Gewinn zu erzielen suchten. Dieses Bestreben hatte auch die Ausweitung der Produktion und der internationalen Verbindungen zur Folge. Die Handelshäuser wurden von Kaufl euten vor Ort geleitet, während Mitarbeiter die auswärtigen Geschäfte abwickelten. Die Kapitalgrundlage der Handelshäuser stammte aus dem Fernhandel oder aus einer Beteiligung mehrerer Kaufl eute, die ihr Kapital zur Verfügung stellten. Die Geschäftsbereiche erstreckten sich auf den (Fern-)Handel, das Verlagswesen und Geldgeschäfte (u M6). Besonders einträglich war der Fernhandel, der aus den enormen regionalen Preisunterschieden satte Gewinne erwirtschaften konnte. Dafür musste man jedoch ein Nachrichtenund Geschäftsnetz aufbauen, das ständig auf den Markt reagierte. Die großen Handelshäuser der Kaufmannsfamilie Medici in Florenz und der Fugger in Augsburg unterhielten zu diesem Zweck schon im 15. Jahrhundert in ganz Europa auswärtige Geschäftsstellen (Faktoreien). Die Handelshäuser betätigten sich auch im Verlagswesen, indem sie Heimarbeitern Rohstoffe (z. B. Tuche) gaben, die daraus Fertigprodukte (Kleider) herstellten. Das Handelshaus mit seinen Marktbeziehungen übernahm den Verkauf. Außerdem wurden hohe Gewinne im Bergbau erzielt. Die Handelshäuser verfügten daher zeitweilig über ein gewaltiges Kapital, das sie für den teuren Schiffsbau einsetzen oder an Fürsten verleihen konnten. Weil diese Kredite oft nicht mehr zurückgezahlt wurden, auch die Gewinne aus dem Bergbau und anderen Geschäftszweigen zurückgingen, gerieten die Handelshäuser um 1600 in eine Krise. Der Kapitalismus der (Handels-)Kompanien Die Handelshäuser gaben der europäischen Expansion in Amerika, Afrika und Asien im 16. Jahrhundert noch den notwendigen organisatorischen Rückhalt, verloren aber danach ihre Bedeutung. An ihre Stelle traten die (Handels-)Kompanien, die im 17. und 18. Jahrhundert weltweit den Handel und die koloniale Ansiedlung organisierten. Am erfolgreichsten waren die niederländische und die englische Ostindienkompanie. Die Kompanien entsprachen insoweit heutigen Aktiengesellschaften, als die Anteilseigner Kapital zur Verfügung stellten, womit sie ein Recht auf Gewinnanteile erwarben. Solche Kapitalbeteiligungen kannten schon die Handelshäuser, desgleichen die Buchführung oder das Betreiben von Faktoreien. Aber die Kompanien waren darüber hinaus mit staatlichen Rechten ausgestattet. Sie bauten eine eigene Verwaltung auf, hatten das Recht, selbstständig Verträge zu schließen und Krieg zu führen, und sie erhielten ein Handelsmonopol, die Ostindienkompanien z. B. für den Indischen und Pazifi schen Ozean. Auch die Kompanien strebten danach, den Gewinn aus dem eingesetzten Kapital zu maximieren. Sie operierten in noch größerem Maßstab als die Handelshäuser und noch intensiver im Handel. Deshalb bezeichnet man ihre Wirtschaftsform als Kaufmannsoder Handelskapitalismus. i Eine Handels gesellschaft um 1500. p Erläutern Sie die Geschäftsfelder und ihren Zusammenhang. Internettipp: Zum Frühkapitalismus siehe Code 32021-05 83Europa in der Welt – Kolonialismus Nu r z u Pr üf zw ec ke n E g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 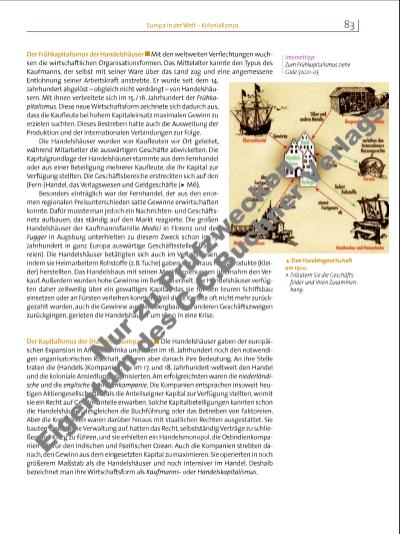 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |